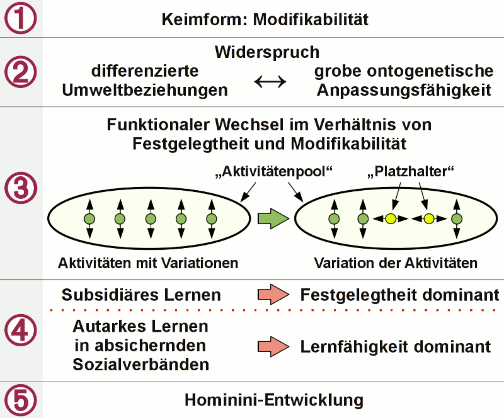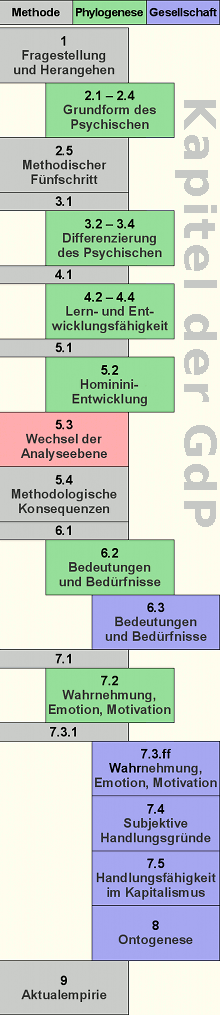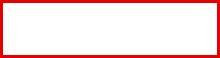4. Lern- und Entwicklungsfähigkeit
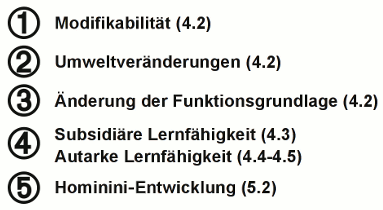
Abb. 9: Die Entstehung der Lern- und Entwicklungsfähigkeit im zweiten Fünfschritt (alle Fünfschritte: Bild anklicken).
Nun steht der nächste Fünfschritt an — die Nachzeichnung der evolutionären Entstehung der individuellen Lern- und Entwicklungsfähigkeit (vgl. Abb. 9).
Ausgangspunkt auf der Seite der Individuen ist die Modifikabilität. Damit ist die Variationsbreite eines genetisch festgelegten Merkmals gemeint, also die Spanne, in der sich die individuell unterschiedlichen Ausprägungen des Merkmals bewegen können. Die jeweiligen Ausprägungen selbst, also die Modifikationen, werden jedoch nicht weitervererbt.
Das Konzept der Modifikabilität wurde durch aktuelle Forschungen der Epigenetik untermauert. Die Epigenetik untersucht, wie Modifikationen von Zelleigenschaften bei der Zellteilung an nachfolgende Zellgenerationen weitergegeben werden Dies geschieht durch Hemmungs- oder Unterstützungsprozesse beim Auslesen der entsprechenden Gensequenzen. Solche chemisch gesteuerten Modifikationen werden jedoch nicht wieder ins Genom »zurückgeschrieben«. Umgekehrt sind die möglichen Modifikationen und damit die Variationsbreite eines Merkmals genomisch festgelegt. Festgelegtheit und Modifikabilität eines Merkmals bilden also stets ein bestimmtes Verhältnis, wobei die völlige Abwesenheit der Modifikabilität eine Ausnahme darstellt.
Im Verhältnis zur evolutionären Anpassung über große Zeiträume bietet die Modifikabilität eine höhere Potenz zur Anpassung an veränderte Umweltbedingungen während der individuellen Entwicklung (Ontogenese) des Organismus. Sind jedoch die Umweltveränderungen zu schnell oder in ihren Auswirkungen zu differenziert, kann auch die Modifikabilität im Verhältnis dazu zu langsam und zu unflexibel sein. So können einmal per Modifikation ausgeprägte Merkrmale unter Umständen nicht mehr verändert werden etc.
Es kommt zu einem Entwicklungswiderspruch, der evolutionär nur in Richtung einer noch flexibleren Reaktion auf aktuelle Veränderungen, die sich während der Lebenszeit des Individuums abspielen, gelöst werden. Dabei muss die Modifikabilität in Richtung der Ausbildung von Lernfähigkeit überschritten werden. Die dafür notwendigen Entwicklungsschritte werden in den nächsten Kapitel nachgezeichnet.
4.1 Von der Festgelegtheit zur Lernfähigkeit
Die Variationsbreite eines genomisch festgelegten Merkmals, die Modifikabilität, ist der Ansatzpunkt für die Herausbildung der Lernfähigkeit. Unter bestimmten Umweltbedingungen reicht die Anpassungsgeschwindigkeit und -differenziertheit der Modifikabilität nicht mehr aus. Wie kommt es zum Funktionswechsel in Richtung auf die Lernfähigkeit?
Nebenstehende Abbildung 10 veranschaulicht den ersten qualitativen Sprung (=Funktionswechsel im dritten zweiten Fünfschritt) am Beispiel eines »Pools« von Aktivitäten. Vor dem Funktionswechsel können die festgelegten Aktivitäten in einer gewissen Variationsbreite während der Ontogenese, der Inidividualentwicklung, modifiziert werden (vertikale Pfeile), während die Art der Aktivitäten selbst festgelegt ist. Nach dem Funktionswechsel treten an die Stelle festlegter Aktivitäten »Platzhalter«, die erst während der Individualentwicklung ausgefüllt werden. Dabei ist nun auch Art der Aktivität variabel (horizontale Pfeile). Damit kann der Organismus nun schneller auf sich ändernde Umweltanforderungen durch individuelle Anpassung »reagieren«.
Neben dem evolutionär entstandenen Artgedächtnis, das die festgelegten Funktionsgrundlage repräsentiert, bildet sich schrittweise ein funktionales Individualgedächtnis, in dem die individuellen Lernerfahrungen gespeichert werden.
Im vierten Schritt, dem Dominanzwechsel, kommt es nun zu einer Aufspaltung in unterschiedliche Lernformen. Das subsidiäre und das autarke Lernen werden im nächsten Kapitel erläutert.
Im fünften Schritt befinden wir uns schließlich bereits mitten in der Hominini*-Entwicklung (dargestellt in Kapitel 5), womit auf dem Wege zur Herausbildung der gesellschaftlichen Natur des Menschen die naturgeschichtliche Rekonstruktion an ihre Grenze gelangt.
*Anmerkung: In der GdP wird durchgehend die alte, bis in die 1980er Jahre übliche Bezeichung Hominiden verwendet. Gemäß der neueren Taxonomie lautet die korrekte Bezeichnung für die Gattung »Homo« Hominini, während die Hominiden alle Menschenaffen (Hominidae, früher: Pongidae) umfasst, die in der GdP als Pongiden bezeichnet werden. In dieser Einführung wird die aktuelle Bezeichnung verwendet.
4.2 Subsidiäres Lernen im Rahmen der Festgelegtheit
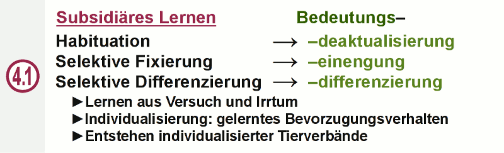
Abb. 11: Dominanzwechsel der Lernfähigkeit, Schritt 4.1: Subsidiäres Lernen (Klicken für Übersicht über alle drei Analyseschritte)
Mit der Durchsetzung der Lernfähigkeit entwickelt sich nicht nur eine Form – etwa »die« Lernfähigkeit schlechthin –, sondern unterschiedliche Formen mit unterschiedlicher Reichweite. Da die Fähigkeit zum Lernen nicht alternativ zur Festgelegtheit steht, sondern selbst einer festgelegten genomischen Grundlage bedarf, ist es sinnvoll, Lernfähigkeit und Festgelegtheit stets als Verhältnis zu begreifen und danach zu fragen wie genau dieses Verhältnis beschaffen ist. Ist die Festgelegtheit dominant, so geht es um das subsidiäre Lernen, ist umgekehrt die Lernfähigkeit dominant, um das autarke Lernen.
Mit dem autarken Lernen wird zwar der Dominanzwechsel im vierten Schritt des Fünfschritts erreicht (Kapitel 4.3), dies jedoch nicht auf Kosten des unentwickelteren subsidiären Lernens, sondern in Ergänzung dazu. Daher ist es notwendig, die Analyse im vierten Schritt zu differenzieren (vgl. Abb. 9). Zunächst also zum Analyseschritt 4.1, dem subsidiären Lernen (Abb. 11).
Die Habituation (Gewöhnung) ist die einfachste subsidiäre Lernform, bei der der Organismus abnehmend auf wiederholte Reize reagiert, wenn sich diese als »überflüssig« herausgestellt haben (z.B. Einziehen der Augenstile bei der Schnecke). Es handelt sich hier um eine Bedeutungsdeaktualisierung, die allerdings sofort wieder aufgehoben wird, wenn sich die Reizkonstellation ändert.
Das »Gegenstück« zur Habituation ist die Bedeutungseinengung anhand von Zusatzmerkmalen, auch selektive Fixierung genannt. Hier reagiert der Einzelorganismus zunehmend genauer auf Situationen, für die zusätzliche Merkmale als relevant gelernt werden (z.B. sog. EAAM: durch Erfahrung modifizierter angeborener Auslösemechanismus).
Das Differenzierungslernen oder die selektive Differenzierung als gelernte Bedeutungsdifferenzierung schließlich ist die höchste subsidiäre Lernform. Holzkamp schreibt:
»Die Fähigkeit zum Differenzierungslernen ist die individuelle Spezifizierbarkeit der früher dargestellten Fähigkeit zur Unterscheidung (Diskrimination) von Bedeutungseinheiten in der Orientierungsaktivität. (…) Die … globalen artspezifischen Bedeutungstypen werden dabei … durch Lernen ›individualisiert‹. Aus diese Weise individualisiert sich das jeweilige Tier selbst… « (134)
Im Rahmen des festgelegten Aktivitätsspektrums lernt das Individuum, die Aktivitätsmodifikationen genauer auf unterschiedliche Situationen abzustimmen, um so zu einer zielgerichteten Energiemobilisierung zu kommen. Dazu gehört das Lernen aus Fehlern (Versuch und Irrtum) und das Lernen der Vermeidung von Fehlern. Erlernte Aktivitätsmodifikationen etwa zur Vermeidung von Fehlern müssen jedoch auch wieder »verlernt« werden, wenn die ursprüngliche Fehlersituation entfällt, da einzeln differenzierend (»analytisch«) gelernte Bedeutungseinheiten noch nicht zur einer »Gesamtbedeutung« zusammengefügt (»synthetisiert«) werden können.
Die subsidiären Lernaktivitäten werden wie alle Aktivitäten emotional gewertet und auf diese Weise unterstützend oder abschwächend ausgerichtet. Eine positiv anleitende und orientierende Funktion bekommt die Emotionalität bei der höchsten subsidiären Lernform, dem Differenzierungslernen. Das Lernen zusätzlicher Bedeutungseinheiten, die zu bevorzugen oder vermeiden sind, ist emotional befriedigend und wird im individuellen »emotionalen Gedächtnis« gespeichert. Es ist objektiv funktional im Sinne der erhöhten Überlebenswahrscheinlichkeit des Individuums und damit der Art.
Die gelernten Bedeutungsdifferenzierungen und Bevorzugungen beziehen sich auch auf die Artgenossen im Sozialverband. Erst gelernte Differenzierungen ermöglichen das Entstehen von individualisierten Sozialstrukturen, in denen einzelne Tiere unterschiedliche soziale Bedeutungen besitzen (etwa einen Rang in einer Dominanz-Hierarchie im Tierverband).
In den nächsten beiden Kapiteln wird das autarke Lernen (Analyseschritt 4.2) und die Bedeutung der schützenden Sozialverbänden für die Dominanz der autarken Lernfähigkeit (Analyseschritt 4.3) vorgestellt.
4.3 Autarkes Lernen und Motivation
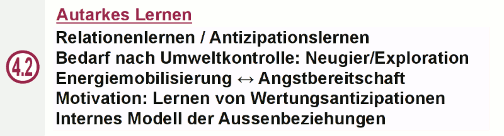
Abb. 12: Dominanzwechsel der Lernfähigkeit, Schritt 4.2: Autarkes Lernen (Klicken für Übersicht über alle drei Analyseschritte)
Mit dem autarken Lernen (vgl. Abb. 12) wird aus der bloßen Variation einzelner Aktivitäten (vgl. Kapitel 4.1, Schritt 3: Funktionswechsel) die gelernte Veränderung von bisher festgelegten linearen Aktivitätssequenzen. Darin ist gleichzeitig eine neue Stufe des Orientierungslernens eingeschlossen. Es reicht nun nicht mehr aus (wie noch beim selektiven Differenzierungslernen), zusätzliche Bedeutungseinheiten zu erfassen, um die damit verknüpfte Aktivität umzusetzen. Die mit einer Aktivitätenabfolge verbundenen Bedeutungen müssen nun erkundend so gelernt werden, dass der reale Zusammenhang der Erkundungsschritte mit dem Ziel der Aktivitätenabfolge faktisch hergestellt werden kann.
Wenn die Verbindungen von Aktivitäten zu Aktivitätssequenzen gelernt werden, betrifft das auch die damit verbundenen bedeutungsvollen Signale. Das Tier stellt auf diese Weise einen zeitlichen Verweisungszusammenhang zwischen den aktuellen Orientierungsbedeutungen und -aktivitäten und den angestrebten zukünftigen Primärbedeutungen und -aktivitäten her. Das antizipatorische Lernen ist hier jedoch keineswegs mit einer »Einsicht« im menschlichen Sinne verbunden, sondern Antizipation ist hier als emotional gesteuerte faktische Vorwegnahme zu verstehen, in der der Bezug zwischen Gegenwärtigem und Zukünftigem »automatisch« hergestellt wird.
Holzkamp hebt die Qualität des Dominanzwechsels von der Festgelegtheit zur Lernfähigkeit so hervor:
»In diesem ›Signallernen‹ liegt in gewisser Hinsicht eine neue Stufe des ›Auf-den-Begriff-Kommens‹ des Psychischen selbst, indem die Signalvermitteltheit der Aktivität als zentrale Bestimmung des Psychischen hier nicht mehr nur objektiv in phylogenetisch festgelegten Bedeutungen sich quasi ›hinter dem Rücken‹ des Tieres durchsetzt, sondern … vom Tier selbst durch Lernen hergestellt werden muß …« (142)
Das Lernen von Signalzusammenhängen ist auf neuer Stufe wiederum objektiv funktional im Sinne der Erhaltung der Art in der evolutionären Entwicklung. Es bezieht sich nicht nur auf zeitliche, sondern auch auf sachliche Relationen. Sachliche und zeitliche Relationen können nicht nur gelernt werden, sondern müssen nun auch gelernt werden. Umweltgegebenheiten sind nicht mehr fixe Aktivitätsauslöser, sondern Aktivitätsanreger in dem Sinne, dass die »Diskrepanz zwischen schon Gelerntem und Neuem« (143) permanent dazu drängt, aufgehoben zu werden. Die emotionale Regulation schwankt jedoch zwischen Energiemobilisierung und Angstbereitschaft, da unklar ist, ob die Diskrepanz vermindert oder zur Gefahr werden kann. Als manifeste Angst wird jener Zustand bezeichnet, in dem das Tier akut aktivitätsunfähig ist und weder Erkundungsenergie mobilisieren noch sich zurückziehen kann.
Die emotionale Steuerungsgrundlage ist nun ein globaler Bedarf nach Umweltkontrolle, der mittels eines Neugier- und Explorationsverhaltens befriedigt werden kann. Auch »Kontrolle« darf hier nicht vermenschlichend missverstanden werden, sondern ist notwendiger und faktischer Effekt der Dominanz der Offenheit und damit der Unsicherheit gegenüber der Festgelegtheit beim autarken Lernen.
Gelernte Orientierungsbedeutungen, ihre emotionale Bewertung und die antizipatorische Verbindung zu entsprechenden Ausführungsbedeutungen werden im Individualgedächtnis gespeichert. Mit jedem Lernschritt sinkt die Diskrepanz zwischen Bekanntem und Neuem und bietet die Grundlage für die nächsten Explorationsschritte. Damit bildet sich
»ein selbständiges ›internes Modell‹ von Außenweltbeziehungen … heraus…, das eine der Voraussetzungen für eine nicht an die Anwesenheit der ›kognizierten‹ Tatbestände gebundene, also ›denkende‹ Informationsverarbeitung darstellt« (150)
Die gelernte Wertungsantizipation wird als Motivation bezeichnet. Die Motivation spiegelt die Bewertung zukünftiger, vorausgeahnter (antizipierter) Situationen wider, die eintreten, wenn gegenwärtig bestimmte Aktivitäten ausgeführt werden. Der Zukunftsbezug der emotionalen Regulation des autarken Lernens sorgt dafür, dass tatsächlich Lernschritte unternommen werden, obwohl die gegenwärtige Situation nicht emotional bewertet werden kann, da sie noch »neu« ist. Das schließt ein, dass nun die Befriedigung primärer Bedarfsspannungen zurückgestellt werden kann, wenn die antizipierte Situation eine höhere Befriedigung verspricht.
Motivation ist auf tierischem Niveau der Automatismus, der dafür sorgt, dass Lernaktivitäten unternommen werden. Eine weitere Vorsetzung, dass es in einer Situation der Offenheit zum autarken Lernen kommt, ist die Absicherung durch Sozialverbände — was im nächsten Kapitel erklärt wird.
4.4 Individuelle Entwicklung in Sozialverbänden
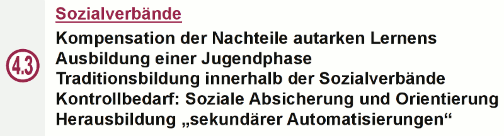
Abb. 13: Dominanzwechsel der Lernfähigkeit, Schritt 4.3: Absichernde Sozialverbände (Klicken für Übersicht über alle drei Analyseschritte)
Das autarke Lernen kann sich evolutionär gegenüber der Festgelegtheit und dem subsidiären Lernen nur durchsetzen, wenn die Selektionsnachteile der Unsicherheit und Offenheit in der Lernphase kompensiert werden. Diese Funktion übernehmen die Sozialverbände, in die das lernende Individuum eingebunden ist (vgl. Abb. 13).
Die Sozialverbände basieren ihrerseits auf gelernten Sozialbeziehungen, die die Absicherung des individuellen Lernens ermöglichen. Die einzelnen Tiere durchlaufen eine Jugendphase, wodurch die Lernfähigkeit zur individuellen Entwicklungsfähigkeit wird. Entsprechende Schutz- und Anleitungsaktivitäten durch die Elterntiere und insgesamt durch den Sozialverband bieten den notwendigen Unterstützungsrahmen. Das Spielverhalten der Jungtiere dient der Vorbereitung auf den späteren Ernstfall, die durch eine entsprechende »Funktionslust« emotional aktiviert wird.
Innerhalb der Sozialverbände ermöglicht das Beobachtungslernen eine tierische Traditionsbildung, mit dem individuelle Lernerfahrungen sozial von einem Tier auf andere Tiere übertragen werden. Dabei kommt dem Erlernen sozialer Bedeutungen und Aktivitäten, dem Einüben sozialer Kommunikationsformen und die Einfindung in den Sozialverband eine wichtige Rolle zu. Störungen des sozialen Lernens können psychische Störungen bei individuellen Tieren zur Folge haben, was bis hin zum Ausschluss aus dem Sozialverband führen kann.
Der globale Kontrollbedarf und die Motivation richten sich folglich zunehmend auf die Integration in den Sozialverband und werden zum Bedarf nach sozialer Absicherung und Orientierung. Der individuellen Kontrolle über die Sozialaktivitäten und Sozialbeziehungen steht die Angstbereitschaft gegenüber, diese Kontrolle zu verlieren und damit auch die individuellen Vorausetzungen für die motiviert-gerichteten antizipatorischen Lernprozesse — was die Existenz des Individuums in Frage stellen kann. Daraus ergibt sich auch die objektive Funktion für die Arterhaltung im evolutionären Prozess: Motiviertes autarkes Lernen in absichernden Sozialverbänden erhöht den Selektionsvorteil gegenüber subsidiären Lernformen.
Eine weitere Möglichkeit, die Offenheit und Langsamkeit autark erlernter gegenüber festgelegten Aktivitäten zu kompensieren, ist die Ausbildung sekundärer Automatisierungen, die an die Stelle der artspezifischen, festgelegten primären Automatismen treten. Wiederholt eingeübte Aktivitäten stehen prompt zur Verfügung, können durch Umlernen jedoch auch wieder verändert werden.
Die Lernfähigkeit hat sich dann im Evolutionsprozess dann durchgesetzt, wenn es nicht mehr ohne sie geht, wenn also
»das Tier ohne den individuellen Entwicklungsprozeß wesentliche Bestimmungen seiner artspezifischen Aktivitätsmöglichkeit nicht mehr zu realisieren vermag. (…) Die Einzeltiere können … ohne die ›erfolgreiche‹ Hineinentwicklung in den Sozialverband ihre individuelle Existenz nicht mehr sichern, da sie in ihren artspezifischen Fähigkeiten verkümmern und ›lebensunfähig‹ werden (›ein isolierter Affe ist kein Affe‹)« (157)
4.5 Kritik behavioristischer Tierexperimente
Klassische behavioristische Reiz-Reakions-Theorien gehen davon aus, dass Lernen universell-organismischer Natur ist und folglich in prinzipiell gleicher Weise sowohl bei Tieren wie auch beim Menschen gefunden werden kann. Die naturgeschichtliche Rekonstruktion der Entstehung der Lernfähigkeit zeigt jedoch deutlich, dass dabei nicht nur in unzulässiger Weise Ergebnisse aus Tierexperimenten auf den Menschen übertragen werden, sondern dass es auch bei Tieren keinen »abstrakten Lernorganismus« gibt, dessen Funktionsweise auf »elementaren Lernmechanismen« beruht. Wie gezeigt, ist die Lernfähigkeit artspezifisches Resultat des jeweiligen evolutionären Entwicklungsprozesses einer Art in ihrer Umwelt.
Faktisch zeigt sich die Artspezifik des Lernens auch in Tierexperimenten. Durch einen entsprechend zugeschnittenen Versuchsaufbau werden jedoch die Voraussetzungen dafür geschaffen, universalisierend formulierte Lernhypothesen stets zu bestätigen. So werden die künstlichen Umwelten der Versuchstiere auf eine Weise konstruiert, dass sich ein quantifizierbares Ergebnis erzielen lässt, womit »qualitative« Fragen nach der Artspezifik von vornherein ausgeblendet sind. Dennoch schlägt die Artspezifik der Versuchstiere immer wieder durch: Waschbären zeigten ihr arttypisches Waschverhalten, anstatt wie intendiert Münzen in ein Sparschwein zu stecken etc. Eine derartige Dressur zeigt sich folglich als erzwungene Abweichung vom arteigenen Aktivitätsrepertoire.
Mit diesen Überlegungen ist auch die gängige Gegenüberstellung von »angeboren« und »erlernt« einschließlich quantifizierender Relationen zurückzuweisen. Die Lernfähigkeit entwickelte sich nicht auf Kosten der Festgelegtheit, sondern konnte nur auf Grundlage der festgelegten, prompt zur Verfügung stehenden Funktionen entstehen. Die Lernfähigkeit steht nicht in einem Ausschließungsverhältnis zum Angeborensein, sondern die Fähigkeit zum Lernen selbst ist angeboren.
Lernfähigkeit und Festgelegtheit sind folglich als Widerspruch zu begreifen, deren Verhältnis sich in der Evolution auf den jeweils neu erreichten Entwicklungsniveaus immer wieder neu herstellt und die Voraussetzung für neue Entwicklungsschritte ist. Dabei ist nicht nur ein erreichtes Niveau an Absicherung auf Basis der festgelegten Funktionen die Voraussetzung qualitativ neuer Entfaltung des Lernens, sondern umgekehrt bietet ein erreichtes Niveau der Lernfähigkeit auch die Voraussetzung für eine eigene evolutionäre Entwicklung festgelegter Funktionen (dies wird später näher erläutert).
Zum Abschluss ein eindrucksvolles Exemplar einer Übertragung von Ergebnissen aus Tierexperimenten auf den Menschen:
Männer, die bei der Auseinandersetzung mit Konkurrenten den Kürzeren ziehen, müssen nicht nur die Schmach verwinden — auch die Zuneigung ihrer Partnerin könnte empfindlich leiden. Das schließen Biologen von der Stanford University aus Experimenten mit Buntbarschen. (»Der Spiegel«, 6.12.2010)