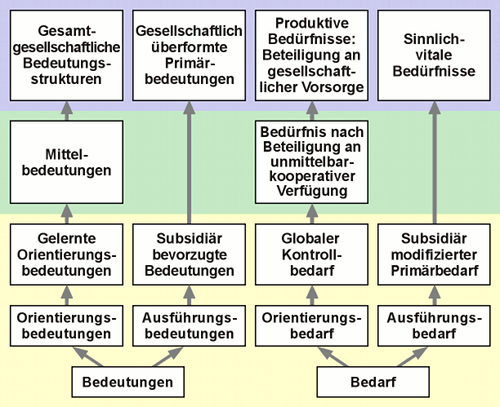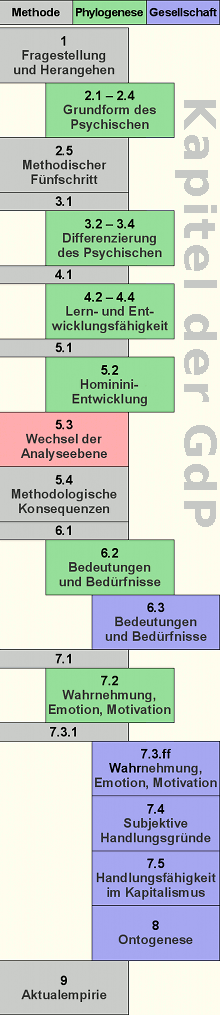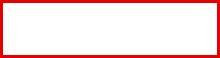9. Bedeutungen und Bedürfnisse (Menschen)
Mit dem Dominanzwechsel wird das phylogenetische Entwicklungsprinzip von der gesellschaftlich-historischen Entwicklung abgelöst. Die frühgesellschaftlichen Sozialkooperationen, die ihre kooperative Lebensgewinnung noch innerhalb von überschaubaren Gruppen (Dorf, Horde, Stamm o.ä.) organisierten, werden nun zu unselbstständigen Bestandteilen einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen Vernetzung und Integration.
Anthropologische Forschungen konnten zeigen, dass es die übergreifende ›Vernetzung‹ der lokalen Sozialverbände des frühen modernen Menschen in Europa war, die sein Überleben sicherte, während die schwach ›vernetzten‹ Neanderthaler-Gruppen schließlich ausstarben. Dabei bedeutet ›Vernetzung‹ nicht bloß ›Kontakt‹, sondern gruppenübergreifender gegenständlicher und kommunikativer Austausch bis hin zum Aufbau vereinheitlichter und damit optimierter jungsteinzeitlicher ›Werkzeugindustrien‹ in ganz Europa.
Die begrenzten kooperativen Bedeutungsstrukturen der überschaubaren Lebensverbände werden damit zu gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen synthetisiert und integriert:
»Die jeweiligen einzelnen Lebens- bzw. Produktionseinheiten werden … zunehmend ein unselbständiger Teil umfassender Lebens- und Produktionszusammenhänge, sind also nicht mehr für sich funktionsfähig und mithin in ihrer Bedeutung für die Existenz des Einzelnen nicht mehr aus sich heraus verständlich.« (230)
Der durch die Bedeutungstrukturen repräsentierte übergreifende objektive Handlungszusammenhang enthält die Notwendigkeiten der arbeitsteiligen Herstellung der Lebensbedingungen und sorgt für die Integration der Individen. Die Existenz der Individuen ist nunmehr gesamtgesellschaftlich vermittelt, denn
»… über die Erfassung, Umsetzung und Änderung der Bedeutungen [ist] jedes einzelne Individuum in seiner personalen Existenz auf den gesamtgesellschaftlichen Lebenszusammenhang bezogen« (234)
Aufgrund der biotischen Potenz zur Vergesellschaftung, der gesellschaftlichen Natur, sind die Individuen fähig, sich in die Gesellschaft hineinzuentwickeln, an ihr teilzuhaben und sie zu gestalten.
Zur Kennzeichnung der beiden Seiten des Vermittlungszusammenhangs von Gesellschaft und Individuum (vgl. dazu die methodischen Vorüberlegungen in Kap. 8.2) wird begrifflich zwischen Arbeit und Handlung unterschieden. Arbeit ist eine gesellschaftstheoretische Kategorie zur Erfassung des Aspekts der historisch spezifischen Art und Weise der Produktion und Reproduktion der Lebensbedingungen als objektivem Handlungszusammenhang. Handlung ist eine individualtheoretische Kategorie zur Erfassung des psychischen Aspekts der Erhaltung und Entwicklung der individuellen Existenz unter den gegebenen Bedingungen, also der individuellen Erfassung, Umsetzung und Änderung des objektiven Handlungszusammenhangs.
Die inhaltliche Kategorialanalyse des Mensch-Welt-Verhältnisses beginnt im nächsten Kapitel mit der Herausbildung der Schriftsprache als neuer Qualität der Kommunikation. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung der gesamtgesellschaftlichen Integration.
9.1 Schriftsprache
Neben der gegenständlichen Fixierung von Produktionswissen ›in‹ den hergestellten Gebrauchsgegenständen und Arbeitsmitteln und ihrem überregionalen Austausch, ist die stofflich-dauerhafte Fixierung symbolischer Bedeutungen entscheidender Faktor für die Durchsetzung der gesamtgesellschaftlichen Integration. Die Sprache war noch vor dem Dominanzwechsel entstanden (vgl. Kap. 6.3), womit ein Medium symbolisch-begrifflicher Repräsentanz gegenständlicher Bedeutungen zur Verfügung stand. Sie war jedoch an den aktuellen Sprechvorgang gebunden, so dass eine Erfahrungsweitergabe nur durch (noch ›tierische‹) soziale Traditionsbildung erfolgen konnte.
Dies ändert sich nun qualitativ:
»Nach dem Dominanzwechsel von der phylogenetischen zur gesellschaftlich-historischen Entwicklung dagegen wurde die Sprache zum umfassenden Mittel der symbolischen Repräsentanz der dabei entstehenden raumzeitlich übergreifenden verselbständigten Bedeutungsstrukturen. Dies wurde dadurch möglich, dass der Sprache im Zuge der Entstehung von Produktionsweisen als gesamtgesellschaftlichen Strukturen über die akustischen Signale als Träger der Kommunikation hinaus ein neues Medium von gegenständlich-überdauernder Beschaffenheit zuwuchs, das Medium der Schrift.« (230)
Holzkamp geht in der GdP davon aus, dass bildende Kunst und Schrift die jungsteinzeitliche bildliche Symbolik als gemeinsamen Ursprung besitzen. In einem eigenen Entwicklungszug entwickeln sich aus bildlichen Repräsentanzen sprachlich-lautlicher Bedeutungen über eine zunehmende Abstraktion (Piktogramme, Ideogramme, Phonogramme, Determinative, Zeichensysteme, Alphabete) und soziale Vereindeutigungen verschiedene Schriftsprachen. Durch den Abstraktionsprozess kam es zu verselbstständigten Entwicklungen der Zeichen- und der Bedeutungsseite von Sprachen. Gleiche Bedeutungen sind so mittels unterschiedlicher Zeichen darstell- und folglich ineinander übersetzbar.
Holzkamp betont, dass Zeichen zwar wechselseitig ersetzt werden können, aber ohne einen Begriff, den sie darstellen, niemals die Zeichensphäre verlassen, sondern »quasi in der Luft« (232) hängen:
»Niemand versteht, auf was sich die Bezeichnung ›Hammer‹ und ›martello‹ gleichermaßen beziehen soll, wenn er nicht einen Begriff hat, der die gesellschaftlich produzierte gegenständliche Bedeutung als spezifische verallgemeinerte ›Brauchbarkeit‹ dessen, was einmal ›Hammer‹ und einmal ›martello‹ genannt wird (und beliebig anders genannt werden kann) repräsentiert. ›Begriffe‹ sind also, anders als die Zeichen, mit denen sie kommuniziert werden, keineswegs austauschbar und u.U. bloßes Konventionsresultat, sondern … in letzter Instanz über die Bedeutungen, die sie repräsentieren, symbolische Fassungen der von Menschen geschaffenen gegenständlichsozialen Verhältnisse in ihrer wirklichen Beschaffenheit.« (231)
Kurz: Zeichen können Konventionsresultat sein, die Bedeutungen, auf die sie sich beziehen, jedoch nicht, denn diese sind Resultat der vorsorgenden Herstellung der Lebensbedingungen.
Dies gilt im strengen Sinne auch für künstlich geschaffene ›Kleinwelten‹, für die Zeichen-Bedeutungs-Relationen explizit festgelegt werden (etwa durch Computerprogramme). Innerhalb der ›Kleinwelt‹ kann zwar das Zeichen X die Aktion Y ›bedeuten‹, bezüglich der realen Lebenswelt, in der solche Kleinwelten geschaffen wurden, handelt es sich jedoch nur um Zeichenwechsel (etwa von einer Bitfolge im Speicher zu einem farbigen Bildpunkt auf einem Bildschirm), deren Bedeutungsgehalt sich erst durch den Bezug zur menschlichen Lebenswelt ›außerhalb‹ des Computers ergibt.
Mit diesem Beispiel wird auch deutlich, dass zeichenbasierte Sprachen ein Aspekt gesellschaftlicher Vergegenständlichungen sind. Der sprachliche Speicher wird zum Bestandteil des gesellschaftlichen Speichers und folglich auch der übergreifenden Funktionseinheit aus gesellschaftlichem und physiologischem Speicher (vgl. Kap. 7.5). Sprachformen sind Denkformen, seien dies Wissenschaftssysteme (Mathematik, Logik, Einzelwissenschaften) oder Ideologien zur Bewältigung der Denk- und Orientierungsanforderungen im Alltag:
»Zur gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz gehört mithin auch die Vermitteltheit der jeweils aktuellen sprachlichen Kommunikation zwischen Individuen durch die objektiven gesellschaftlichen Sprachverhältnisse« (232)
Durch die potenzielle Abwesenheit der gemeinten Sache im schriftsprachlich Dargestellten entsteht eine neue Größenordung der Kumulation gesellschaftlich überdauernder Erfahrungen und Diskurse. Die naturhafte Umwelt wird nun vollends zur geschaffenen Welt auf Basis der »Synthese sämtlicher Daseinsbezüge durch die gesellschaftlich produzierten Bedeutungsverweisungen« (233), in die dann auch das Nichtproduzierte in seiner mittelbaren Bedeutung einbezogen wird: ›Natur‹ als noch zu Verarbeitendes, ›Natur‹ als Unberührtes in abstrakter Entgegensetzung zum Produzierten etc.
Niemand versteht, auf was sich die Bezeichnung ›Hammer‹ und ›martello‹ gleichermaßen beziehen soll, wenn er nicht einen Begriff hat, der die gesellschaftlich produzierte gegenständliche Bedeutung als spezifische verallgemeinerte ›Brauchbarkeit‹ dessen, was einmal ›Hammer‹ und einmal ›martello‹ genannt wird (und beliebig anders genannt werden kann) repräsentiert. ›Begriffe‹ sind also, anders als die Zeichen, mit denen sie kommuniziert werden, keineswegs austauschbar und u.U. bloßes Konventionsresultat, sondern (wie dargestellt) in letzter Instanz über die Bedeutungen, die sie repräsentieren, symbolische Fassungen der von Menschen geschaffenen gegenständlichsozialen Verhältnisse in ihrer wirklichen Beschaffenheit.
9.2 Handlungsmöglichkeit und Handlungsfähigkeit
Mit der gesamtgesellschaftlichen Integration nach dem Dominanzwechsel ist die Gesellschaft ein in sich erhaltungs- und vermittlungsfähiges System. Damit sind nun zwei Vermittlungszusammenhänge zu unterscheiden. Der gesellschaftliche Vermittlungszusammenhang in sich ist bestimmt durch die jeweils historisch spezifische Produktionsweise bzw. Gesellschaftsformation (vgl. Kap. 8.4). Der Vermittlungszusammenhang von Individuum und Gesellschaft ist bestimmt durch die jeweilige Position und Lebenslage unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen (vgl. Kap. 8.3).
Im Gegensatz zur überschaubaren Sozialkooperation ist der Zusammenhang zwischen der Schaffung der Lebensbedingungen und Erhaltung der eigenen Existenz unter Bedingungen der gesamtgesellschaftlichen Integration nicht mehr unmittelbar gegeben. Die in den gesellschaftlichen Bedeutungstrukturen liegenden objektiven Handlungsnotwendigkeiten besitzen nur durchschnittlichen Charakter, deren Umsetzung für den jeweiligen Einzelnen nicht zwingend sind. Die Bedeutungsstrukturen bestimmen zwar gesellschaftlich, was durchschnittlich getan werden muss, aber individuell nur, was getan werden kann. Bedeutungen sind folglich nicht mehr — wie noch vor dem Dominanzwechsel (vgl. Kap. 3.3) — artspezifische Aktivitätsdeterminanten, sondern nurmehr individuelle Handlungsmöglichkeiten.
Dies begründet auch eine besondere menschliche Freiheitsbeziehung zur Welt:
»Da … die Existenzsicherung nicht mehr unmittelbar von der Bedeutungsumsetzung abhängt, … hat [das Individuum] im Rahmen der globalen Erfordernisse der eigenen Lebenserhaltung hier immer auch die ›Alternative‹, nicht oder anders zu handeln, und ist in diesem Sinne den Bedeutungen als bloßen Handlungsmöglichkeiten gegenüber ›frei‹.« (236)
Auch Beschränkungen der Handlungsmöglichkeiten — welcher Art auch immer (Unterdrückung, Manipulation etc.) — ändern nichts der grundsätzlichen Freiheits- und Möglichkeitsbeziehung zur Realität. Zugespitzt wäre ein Rückfall in den absoluten Determinationszustand, also »eine totale Ausgeliefertheit an die Umstände … gleichbedeutend mit dem Ende der menschlichen Existenz« (ebd.).
Die neue Qualität nach der Überschreitung der unmittelbar überschaubaren Lebenszusammenhänge in der Sozialkooperation wurde als gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz gefasst. Die personale Handlungsfähigkeit bezeichnet nun
»die Verfügung des Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozeß« (241)
Diese grundsätzliche Möglichkeit der Verfügung über die Bedingungen ist dem Individuum nicht unmittelbar gegeben, sondern »durch die Lebenslage/Position in ihrer Formationsspezifik vielfältig vermittelt und gebrochen« (ebd.). Es deutet sich an, dass die Handlungsfähigkeit widersprüchliche Erscheinungsformen hat, was in Kapitel 12 näher ausgeführt wird.
Da hier die Existenzsicherung nicht mehr unmittelbar von der Bedeutungsumsetzung abhängt, ist das Individuum aber durch die jeweils konkreten vorliegenden Bedeutungsbezüge in seinen Handlungen keineswegs festgelegt, es hat im Rahmen der globalen Erfordernisse der eigenen Lebenserhaltung hier immer auch die ›Alternative‹, nicht oder anders zu handeln, und ist in diesem Sinne den Bedeutungen als bloßen Handlungsmöglichkeiten gegenüber ›frei‹.
9.3 Bewusstsein und Subjektivität
Die Möglichkeitsbeziehung der Individuen zur gesellschaftlichen Realität (vgl. Kap. 9.2) ist die entscheidende Voraussetzung für die Entstehung des Bewusstseins. Indem nun nicht mehr — wie noch in der Sozialkooperation — jedes Ereignis für die Individuen unmittelbar bedeutsam ist, sondern die eigene Existenz im gesellschaftlichen Zusammenhang miterhalten wird, ist eine vermitteltes, erkennendes und reflektierendes Verhältnis zur Welt möglich geworden. Ein Sachverhalt hat nicht mehr direkt eine Aktivität zur Folge, sondern das Individuum kann sich zunächst zu diesem Sachverhalt in eine gnostische (erkennende) Distanz begeben, die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten ausloten, und sich dann entscheiden, so oder auch anders oder gar nicht zu handeln.
Bewusstsein ist folglich die
»…›gnostische‹ Welt- und Selbstbeziehung, in welcher die Menschen sich zu den Bedeutungsbezügen als ihnen gegebenen Handlungsmöglichkeiten bewusst ›verhalten‹ können, damit nicht mehr in den Erfordernissen ihrer unmittelbaren Lebenserhaltung befangen sind, sondern fähig werden, den übergreifenden Zusammenhang zwischen den individuellen Existenz- und Entwicklungsumständen und dem gesamtgesellschaftlichen Prozess verallgemeinert-vorsorgender Schaffung menschlicher Lebensmittel/-bedingungen zu erfassen.« (237)
Bewusstsein ist also mehr als die Fähigkeit zum antizipatorischen operativen Planen oder zur sprachlichen Kommunikation. Erst mit der Überschreitung des unmittelbaren Rückbezugs der zu planenden oder zu kommunizierenden Sachverhalte auf die eigene Existenz ist eine Unterscheidung von mir als Erkennendem und dem Sachverhalt als dem zu Erkennenden möglich, die ein bewusstes Verhalten zu den Sachverhalten und zu mir selbst erlaubt.
Damit ändern sich auch die Beziehungen der Menschen untereinander:
»Bewusstes ›Verhalten-Zu‹ ist als solches ›je mein‹ Verhalten. ›Bewusstsein‹ steht immer in der ›ersten Person‹. (…) [Ich] erfasse damit die ›anderen Menschen‹ generell als ›Ursprung‹ des Erkennens, des ›bewussten‹ Verhaltens und Handelns ›gleich mir‹.« (237f)
Der andere ist nicht bloß soziales Werkzeug wie auf der Stufe der Sozialkoordination (vgl. Kap. 5.1) oder nur Kooperationspartner bei der vorsorgenden Schaffung der Lebensbedingungen wie auf der Stufe der Sozialkooperation (vgl. Kap. 7.4), sondern Subjekt wie ich, d.h.
»… gleichrangiges, aber von mir unterschiedenes ›Intentionalitätszentrum‹ in seinem ›Verhältnis‹ zu gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und darin zu sich selbst …, und dies ›allgemein‹, d.h. unabhängig davon, ob er gerade in einem aktuellen Kooperations- und Kommunikationszusammenhang zu mir steht.« (238)
Die reziprok-reflexive Verschränkung der je individuellen Perspektiven ist Charakteristikum menschlicher Intersubjektivität:
»Dies gilt auch da, wo unter historisch bestimmten Verhältnissen der andere als Subjekt geleugnet, instrumentalisiert, zum Objekt gemacht wird, da hier die Subjekthaftigkeit des anderen negiert ist, was deren Erkenntnis und Anerkenntnis einschließt: So gewinnt die ›Menschlichkeit‹ interpersonaler Beziehungen aus ihrer Spezifik den Charakter der ›Unmenschlichkeit‹ (ein Tier kann man nicht ›unmenschlich‹ behandeln …)« (ebd.)
Für die Individualwissenschaft hat dies methodisch die Konsequenz, dass die Anderen nicht als Erkenntnisgegenstand auf der Objektseite stehen, sondern es sich bei diesen grundsätzlich um »Unsereinen«, also andere Subjekte handelt. Forschende sind also als Subjekte von den eigenen Forschungsverfahren mitbetroffen (mehr dazu in Kap. 14).
9.4 Bedürfnisse
Mit der Möglichkeitsbeziehung der Individuen zu den gesellschaftlichen Bedingungen ändern sich die Bedeutungs-Bedürfnis-Verhältnisse qualitativ. Abb. 25 zeigt schematisch die Entwicklung von Bedeutungen und Bedarf bzw. Bedürfnissen von der phylogenetischen Stufe einschließlich der Lernfähigkeit (gelb), über die Sozialkooperation (grün) bis zur gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz (blau).
Auf der Seite des Bedarfs ist der globale Kontrollbedarf die emotionale Regulationsgrundlage für die widersprüchliche Steuerung zwischen Energiemobilisierung und Angstbereitschaft angesichts unbekannter sachlicher und sozialer Gegebenheiten in der Umwelt. Aus der bloß individuellen Umweltkontrolle entwickelt sich in der Sozialkooperation die unmittelbar-kooperative Verfügung über die Schaffung der Lebensbedingungen mit dem Ziel der vorsorgenden Absicherung der primären Bedürfnisbefriedigung und Abwendung der Angstbereitschaft.
Mit der gesamtgesellschaftlichen Integration schließlich bilden die produktiven Bedürfnisse die spezifisch-menschliche Bedürfnisgrundlage der individuellen Handlungsfähigkeit. Die komplementären, von der Realisierung der produktiven Bedürfnisse (also dem Grad der Handlungsfähigkeit) abhängigen primären Bedürfnisse werden sinnlich-vitale Bedürfnisse genannt. Holzkamp weist darauf hin, dass zwei Arten von Missverständnissen zu vermeiden seien.
Erstens sei mit dem Begriff der produktiven Bedürfnisse nicht eine Art »Produktionsbedürfnis« gemeint. Es sei auch nicht »irgendeine individuell-kreative Aktivität« angesprochen, sondern »die Bedürfnisgrundlage der individuellen Teilhabe an der Verfügung über den gesamtgesellschaftlichen Produktions-/Reproduktionsprozeß« (242). Unter den Bedingungen der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit der individuellen Existenz ist es nicht mehr möglich, die eigene Existenz vorsorgend bloß unmittelbar-kooperativ abzusichern. Dies geht nurmehr über die Beteiligung am gesamtgesellschaftlichen Prozess vermittelt über die jeweiligen Möglichkeiten in der individuellen Lebenslage und Position angesichts der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse.
Zweitens dürfe die Herkunft der produktiven Bedürfnisse aus dem Kontrollbedarf nicht dazu verleiten anzunehmen, der Mensch habe ein allgemeines »Kontrollbedürfnis« und wolle generell seine Lebensbedingungen »kontrollieren«. »Kontrolle« wäre der Versuch, die fehlende Verfügung über die Lebensbedingungen zu kompensieren und somit ein »Symptom der Isolierung des Individuums von den gesellschaftlichen Verfügungsmöglichkeiten« (243).
Unnummeriert fügt Holzkamp ein dritte »Missdeutung« an, die ebenfalls zu vermeiden sei: Es gebe kein selbstständiges Bedürfnis nach Arbeit:
»Nicht die ›Arbeit‹ als solche ist erstes Lebensbedürfnis, sondern ›Arbeit‹ nur soweit, wie sie dem Einzelnen die Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess erlaubt, ihn also ›handlungsfähig‹ macht. Mithin ist nicht ›Arbeit‹, sondern ›Handlungsfähigkeit‹ das erste menschliche Lebensbedürfnis – dies deswegen, weil Handlungsfähigkeit die allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen und menschenwürdigen Daseins ist, und Handlungsunfähigkeit die allgemeinste Qualität menschlichen Elends der Ausgeliefertheit an die Verhältnisse, Angst, Unfreiheit und Erniedrigung.« (243)
Interessant ist hierbei, dass Holzkamp seinen »Kommentar« als allgemeine (auf keine bestimmte Gesellschaft bezogene) Präzisierung des Marxschen Diktums von der Arbeit als »erste(s) Lebensbedürfnis« (MEW 19, 21) ansieht. Marx bezieht sich auf eine »höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft«, in der »die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben« (ebd.) sei. Kommunismus wird mithin implizit als die Gesellschaft angesehen, die die »Rahmenqualität eines menschlichen und menschenwürdigen Daseins« bietet.
Die Möglichkeitsbeziehung und erkennende Distanz beziehen sich nun nicht nur auf die Welt, sondern auch auf sich selbst als Teil dieser Welt — eingeschlossen die eigenen Bedürfnisse. Das Individuum muss also auftretende Bedürfnisse nicht unmittelbar befriedigen, sondern hat die
»Möglichkeit, seine jeweils gegebene Bedürftigkeit zunächst als solche … ›zur Kenntnis zu nehmen‹, und aus dieser ›gnostischen‹ Beziehung heraus sich zu seinen Bedürfnissen zu ›verhalten‹, d.h. ihre Befriedigung gemäß den gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten zu planen, umzustrukturieren, aufzuschieben, ja sogar seine aktuellen Bedürfnisse um allgemeiner, langfristiger Ziele willen ›bewusst‹ zu vernachlässigen.« (244)
Die fremdbestimmte Unterdrückung von Bedürfnissen erhält ihre »menschliche Spezifik« (mithin Unmenschlichkeit) dadurch, dass nicht nur die Bedürfnisbefriedigung als solche verwehrt bleibt, sondern auch die Möglichkeit des bewussten Verhaltens zu den eigenen Bedürfnissen abgeschnitten wird. Holzkamp veranschaulicht dies an einem Beispiel: Wenn ein Individuum Hunger leidet,
»so leidet es nicht nur isoliert ›Hunger‹ als spezielle Bedürfnis-Spannung, sondern es leidet darin und gleich elementar an seiner Ausgeliefertheit an eine Situation, in welcher es so weitgehend von der vorsorgenden Verfügung über seine eigenen Lebensbedingungen abgeschnitten ist, dass es ›hungern‹ muß« (246)
Es geht also nicht nur um den sinnlich-vitalen Bedürfnisaspekt eines Lebens ohne Hunger, sondern ebenso um den produktiven Bedürfnisaspekt einer Verfügung über die Befriedigungsquellen »ohne die fremdbestimmte Bedrohtheit durch Hunger, also ein menschenwürdiges Leben« (ebd.).
Wenn nun die Unmittelbarkeit des Verhältnisses zwischen Bedürfnissen und Handlungen durchbrochen ist, ändert sich auch der Charakter der Emotionalität. Die emotionale Wertung führt nicht mehr unmittelbar zur Aktivität, sondern wird vom Individuum zunächst bewusst in erkennender Distanz erfahren. Die so gefasste emotionale Befindlichkeit wird zur überdauernden personalen Grundlage der Wertung der Lebensbedingungen des Individuums. Die Befindlichkeit ist der subjektive Maßstab für individuelle Entscheidungen angesichts gegebener Handlungsmöglichkeiten.