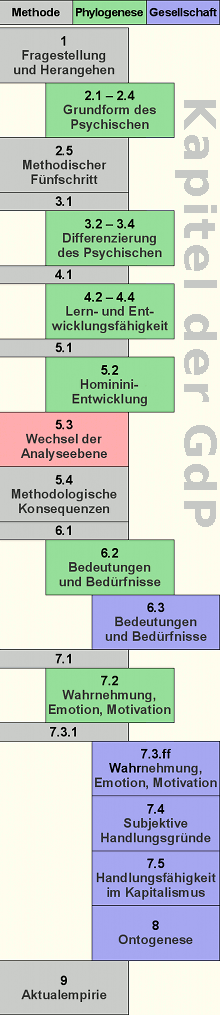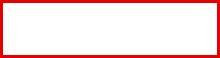Vorher lesen: Antwort auf Michael Zanders Kritik unserer Auffassungen
Utopie und Transformation
Von Stefan Meretz und Simon Sutterlütti
Vorbemerkung: Die Redaktion einer Sonderausgabe des „Forum Kritische Psychologie“ hat eine Gruppe von Menschen, die innerhalb der Kritischen Psychologie neue Positionen vertreten, eingeladen, diese darzulegen. Denis Neumüller, Flavio Stein, Stefan Meretz und Ranjana Schirin Kochanek haben das Angebot angenommen und einen entsprechenden Artikel geschrieben (in: Forum Kritische Psychologie 60, 2020). Michael Zander übernahm es, eine Gegenposition aus traditioneller Sicht zu formulieren (ebd.), auf die wiederum Neumüller et al. (ebd.) reagierten. Zander setzte sich in seiner Kritik ausführlich mit dem Buch „Kapitalismus aufheben“ von Sutterlütti und Meretz (2018) auseinander. Da diese Kritik von der Diskussion um die kategoriale Basis der Kritischen Psychologie wegführte und die Autor*innengruppe sich nicht berufen sahen, eine Quelle (die von Sutterlütti/Meretz), auf die sie referenzierte, inhaltlich zu vertreten, beschränkte sie ihre Antwort auf die im engeren Sinne psychologische Thematik. Da sich die Redaktion nun aber auch eine Befassung mit Zanders Kritik an Sutterlütti/Meretz wünschte, haben wir uns als eben jene Buchautoren entschlossen, diese zu formulieren. Eine Kurzversion des folgenden Textes ist als Anhang zum Artikel von Neumüller et al. erschienen, die Langfassung erscheint hier online.
Wir erleben es immer wieder, dass Linke sich mit würdigender, solidarischer Kritik schwertun. Die Abweichler*innen im „eigenen Lager“ wurden in der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung nicht selten Hauptfeind betrachtet – so etwa die Sozialdemokratie von den Kommunist*innen in den 1930er Jahren oder die Andersdenkenden von der stalinistischen Orthodoxie bis in die 1950er Jahre. Von diesen realen und teilweisen existenziellen Ausgrenzungen sind wir heute glücklicher Weise weit entfernt, doch eine entsprechende Haltung hat überlebt: Es gilt, der „richtigen“ Linie zum Durchbruch zu verhelfen. Das, was heute als „richtig“ gilt, hat sich gleichzeitig gegenüber der Hochzeit der Arbeiter*innenbewegung ziemlich verdünnt: Heute ist es vor allem der bereits verblichene Klassenbegriff, der gegenwärtig als „neue Klassenpolitik“ wiederbelebt werden soll. So ist es verständlich, wenn Kritiker*innen der traditionellen wie erneuerten Klassenrhetorik heftige Abwehr erfahren – so auch wir. Dabei geht es uns nicht darum, die Kategorie „Klasse“ in Gänze zu negieren, sondern darum, den Status des Begriffs bei der Analyse des Kapitalismus neu einzuordnen, um das gleichsam verlassene Feld von Utopie („Wohin wollen wir?“) und Transformation („Wie kommen wir dahin?“) neu erschließen zu können. In den folgenden Punkten, in denen wir uns detailliert mit Zanders Kritik befassen, wollen wir das entwickeln.
Hauptwiderspruchsdenken
(1) Zander schreibt (alle folgenden Zitate aus Zander 2020, FKP 60): „Der pauschale Vorwurf des sogenannten Klassenreduktionismus gegen marxistische Positionen ist derzeit verbreitet, aber falsch. Bereits im späten 19. Jahrhundert kämpfte die sozialistische Arbeiterbewegung gegen die Unterdrückung von Frauen, gegen Rassismus und Imperialismus sowie gegen die Verfolgung von Homosexuellen“. Unabhängig von der Frage, ob die historische Einschätzung zutreffend ist, wird hier ein empirisches Argument gegen eine theoretische Kritik angebracht. Damit wird nicht klar, warum der Vorwurf des Klassenreduktionismus „falsch“ sei. Doch was ist mit „Klassenreduktionismus“ überhaupt gemeint? Hinter dem eher irreführenden Label verbirgt sich das sogenannte „Hauptwiderspruchsdenken“. Es geht davon aus, dass es im Kapitalismus zwar vielfältige Widersprüche gibt, die jedoch hierarchisch angeordnet sind: Der Klassenwiderspruch – der zwischen Kapital und Arbeit – gilt als „Hauptwiderspruch“ (der mithin primär zu lösen sei), demgegenüber alle anderen nur „Nebenwidersprüche“ sind. Es geht also nicht darum, dass es gar keine anderen Widersprüche als den zwischen Kapital und Arbeit gäbe, sondern darum, dass diesem der Vorrang gegeben wird (theoretisch begründet über das Eigentum an Produktionsmitteln) und dass sich daraus die Avantgarderolle der Arbeiter*innenbewegung (und „ihrer Partei“) ableitet. Doch auch die von Zander angebrachte empirische Erklärung – die „Arbeiterbewegung“ habe doch auch andere Formen von Unterdrückung berücksichtigt – ist problematisch. Darin drückt sich erstens eine paternalistische Haltung aus, denn tatsächlich waren es weitgehend eigenständige Kämpfe gegen verschiedene Dimensionen von Unterdrückung, bevor die Arbeiter*innenbewegung sie teilweise zu ihren Forderungen machte. Zweitens wird mit dem Übergehen der Eigenständigkeit der Vorwurf des Hauptwiderspruchsdenkens eher bestätigt, indem andere Emanzipationsbewegungen erneut der „Hauptbewegung“ subsummiert werden.
Die Tatsache, dass es immer wieder eigenständige Kämpfe waren, denen sich die Arbeiter*innenbewegung gegenüber sah, führte tatsächlich zu theoretischen Versuchen, das Hauptwiderspruchsdenken zu überwinden. So gab es, angestoßen durch die zweite Frauenbewegung der 1960/70er Jahre, heftige Diskussionen darüber, ob Klassenwiderspruch und Patriarchat nicht mindestens gleichrangig seien. Die Theorie der „Triple Oppression“ der 1980/90er argumentierte, dass auch die rassistische Unterdrückung hinzugenommen und „gleichzeitig“ überwunden werden müsse. Emanzipatorische Bewegungen brachten immer weitere Herrschaftsdimensionen ins Licht des Sicht- und Sprechbaren: Sexualität, Hautfarbe, Körper, Sprache, Aussehen, Bildung, Alter usw. usf. Diese Entwicklung wirft theoretisch die Frage auf, wie sich die verschiedenen Herrschaftsdimensionen zueinander verhalten. Darauf gibt es, soweit wir das überblicken können, drei Antworten. Die traditionell-marxistische Theorie, der auch Zander anzuhängen scheint, bringt die Herrschaftsformen in ein hierarchisches Verhältnis mit dem Primat auf dem Klassenwiderspruch. Eher poststrukturalistische Ansätze gehen von einer relativen Unabhängigkeit und Gleichwertigkeit aus, deren praktische Überschneidungen (Intersektionalität) Gegenstand von Untersuchungen sind. Gleichsam als Aufhebung beider gegensätzlicher Positionen gehen wir davon aus, dass sich die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse zwar eigenständig entfalten, gleichzeitig aber in einem inneren Zusammenhang stehen, den wir als Exklusionslogik fassen. Mit diesem neuen Begriff fassen wir die Strukturierung kapitalistischer Gesellschaften in Form von Gegensätzen (s.u.). Diese Gegensätze zeigen sich empirisch als eine Bewegung des Sich-auf-Kosten-Anderer-Durchsetzens, wobei zur Aufwertung der eigenen Position andere in ihrer Position abgewertet werden (das sogenannte „Othering“). Dabei ist es historisch kontingent, welche Dimension wann und wo zum Tragen kommt. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass das Othering keine intentionale personale Handlung sein muss (aber kann), sondern dass sich die Diskriminierung und Abwertung strukturell einschreibt und als Nahelegung alltäglich und damit unreflektiert reproduziert wird.
Was ist und wie entsteht die Exklusionslogik? Als Exklusionslogik bezeichnen wir den strukturellen Niederschlag von sozialen Beziehungen, in denen sich die einen auf Kosten von anderen durchsetzen. Dies geschah und geschieht in unterschiedlicher Form. In vorkapitalistischen Zeiten waren es vorwiegend personale und vorwiegend direkt-gewaltförmige Herrschaftsformen, die von entsprechenden ideologischen (vorwiegend religiösen) Rechtfertigungen begleitet wurden – etwa bei der Abpressung des Zehnten von den Bauern durch ihre „Herren“. Im Kapitalismus sind es primär unpersonal-verrechtlichte und eher indirekte Herrschaftsformen, deren wichtigste Instanzen Markt und Staat sind. Auch der Kapitalismus hat seine Rechtfertigungsideologien, die heute nicht mehr religiös, sondern utilitaristisch leistungsbasiert argumentieren. Während sich Herrschaft in vorkapitalistischen Gesellschaften in personalen Hierarchien abbildete, der auf übergeordneten Ebenen mit einem entsprechenden Raum von Privilegien verbunden war, ist Herrschaft im Kapitalismus „plural“ entlang zahlreicher Dimensionen netzwerkartig „verteilt“: Dort wo sich materiell Differenzen in Form realer Exklusionen ausbilden – ob willkürlich-gewaltförmig oder kontingent-leistungsbasiert – ist die entsprechende Rechtfertigung nicht weit. Klassismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus usw. sind strukturell verstetigte Komplexe materiell-realer Exklusionen und entsprechender ideologischer Rechtfertigungen. Die plural-verteilten Herrschaftsformen haben kein organisierendes Zentrum und sie werden auch nicht von außen an „Unschuldige“ herangetragen, sondern Herrschaft wird von den Betroffenen selbst organisiert: Sie geht durch uns hindurch. Die Effizienz von Herrschaft sorgt für das Ausmaß der Privilegien in der jeweiligen Sektion. Besonders effizient ist etwa jene Herrschaft, die gleichsam „unsichtbar“ ist und sich als „natürlicher“ Umstand ausgibt (etwa Sexismus). Oder jene, die auf rechtlichem Ausschluss durch „Eigentum“ und Resultat von „Leistung“ basiert (etwa Klassismus). Unsere These ist nun, dass die konkreten Herrschaftsvarianten Erscheinungsform einer gemeinsamen basalen Dynamik sind – eben jene, die wir Exklusionslogik nennen.
Die basale exklusionslogische Dynamik entspringt der Warenform, die auf die getrennte Privatproduktion zurückgeht. Getrennt zu produzieren bedeutet, tauschen zu müssen, was als entfalteter Äquivalenztausch (gleichwertiger Tausch von Waren) die Tauschlogik hervorbringt. Gleichzeitig befriedigt die konsumierte Ware Bedürfnisse. Der Gegensatz und gleichzeitige Zusammenhang von Vermittlung (Tausch) und Nützlichkeit (Bedürfnisbefriedigung) erzeugt jene Selbstzweckbewegung der Verwertung von Wert, die Marx als „Fetisch“ bezeichnete. Damit meinte er, dass eine sachliche Bewegung (die Wertverwertung) die sozialen Verhältnisse bestimmt. Und diese von der eigenlogischen Bewegung des Werts bestimmten sozialen Verhältnisse sind Exklusionsverhältnisse: Es gibt immer ein „drinnen“ und „draußen“, Inklusion und Exklusion, Privileg und Diskriminierung. Dabei können sich materiell-reale und ideologisch-legitimatorische Privilegierung/Diskriminierung relativ verselbstständigen, bleiben aber aufeinander bezogen. Nicht jede diskriminatorische Handlung „erzeugt“ unmittelbar einen materiellen Vorteil, reproduziert aber in der jeweiligen Sektion jene Logik der Exklusion, nach der bestimmten Personen die materiellen Gewinne zuteil werden, während andere die Kosten zu tragen haben. Spannend ist nun die Frage, ob in den allgemeinen Exklusionsverhältnissen des Kapitalismus der Sektion der Klassenspaltung dennoch eine maßgebliche Bedeutung zukommt, die sie von anderen Exklusionsdimensionen abhebt. Hier sind wir auf theoretische Argumente von Zander und anderen, die weiterhin einen Vorrang der Klassenspaltung sehen, gespannt.
Reform und Revolution – wieder und wieder?
(2) Eine Kritik an der Arbeiter*innenbewegung, dass sie die Utopie einer freien Gesellschaft nicht denken könne, sei, so Zander, „unhistorisch, weil sie von den sozialgeschichtlichen Bedingungen abstrahiert, mit denen sich die Parteien, Gewerkschaften, Genossenschaften und Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert jeweils konfrontiert sahen“. Was bedeutet das? Die entsprechenden Organisationen hätten keine Zeit gehabt, über das Ziel ihres Wirkens nachzudenken? Haben die Bedingungen sie davon abgehalten, darüber nachzudenken? – Das erscheint uns nicht glaubwürdig. Neben den Kämpfen jener Zeit gab es immer auch intensive reflexive Debatten darüber, was Ziel und Mittel der Kämpfe seien. Erinnert sei etwa an die Auseinandersetzung zwischen Eduard Bernstein („Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft“, 1897/98) und Rosa Luxemburg („Sozialreform oder Revolution“, 1898/99) über das probate Mittel zur gesellschaftlichen Transformation seien. Das Problem war vielmehr, dass sich die Debatten allein innerhalb der Alternative von Reform und Revolution bewegten, die jeweils für sich begrenzt sind. Darum geht es in unserem Buch. Wir leisten uns den Luxus, den Gegensatz aus historischer Perspektive zwar als nachvollziehbar, aber dennoch als theoretisch problematisch zu kritisieren. Dies deswegen so relevant, weil der Gegensatz bis heute reproduziert wird.
Was ist der Kern unserer Kritik? Reform und Revolution sind politisch-staatszentrierte Transformationsansätze. Durch die Erringung von politischem Einfluss auf oder gar politischer Herrschaft über den Staatsapparat sollen gesellschaftliche Umgestaltungen eingeleitet werden, die in eine freien Gesellschaft (Kommunismus o.ä.) münden. Diese Vorstellungen konterkarier(t)en sich selbst – nicht nur empirisch, sondern auch theoretisch. Erstens fehl(t)en diesen Ansätzen Vorstellungen darüber, wie die Lebensbedingungen nach dem „Ende“ des Kapitalismus hergestellt werden können. So griffen und greifen reale Bewegungen stets auf die bekannten Formen der Warenproduktion zurück, womit sie trotz u.U. gegenteiliger politischer Herrschaft die kapitalistische Basis reproduzier(t)en. Irgendwann folg(t)e auch der politische Rückschritt (Aufgabe des Realsozialismus, Mutation der herrschenden Partei zum Quasi-Staat etc.). Zweitens ist eine Vorstellung des abrupten Übergangs unrealistisch. Eine neue Re/Produktionsweise wird nicht per politischem Beschluss eingeführt, sondern sie muss sich bereits in der alten Gesellschaft entwickeln, bevor sie sich schließlich durchsetzen kann. Das war historisch immer so, und – so unsere These – wird auch für den Übergang zu einer freien Gesellschaft nicht anders gehen können. Wir freuen uns stets, wenn sich Kritiker*innen mit diesen beiden Kernpunkten auseinandersetzen. Leider war dies bei Zander nicht der Fall. Das Argument, dass die Arbeiter*innenbewegung anderes zu tun hatte, ist sowohl empirisch unzutreffend und geht – und das ist für uns wesentlich – an der theoretischen Herausforderung, wie eine Transformation kategorial begriffen werden kann, vorbei.
Ebenen der Transformation
(3) Die Alternative, die wir an die Stelle von Reform/Revolution setzten, so Zander, sei die „Idee der (relativ) ‚repressionslosen »Freiräume«‘, in denen man der ‚Leistungsgesellschaft‘ entkommt“. Tatsächlich verwenden wir den Begriff der „repressionslosen Freiräume“ nicht, sondern das Zitat stammt von Klaus Holzkamp von 1972, als es um die Umgestaltung des Psychologischen Instituts ging. Die assoziative Zuschreibung, so haben wir diesen Passus verstanden, sollte illustrieren, dass auch wir das Schaffen von Freiräumen als Weg zur freien Gesellschaft ansehen. Tatsächlich sind wir nicht gegen Freiräume, und wir glauben auch nicht, dass Michael Zander dagegen ist – haben doch etwa die Organisationen, Bildungsvereine, Kulturvereine etc. der Arbeiter*innenbewegung immer auch Freiräume geschaffen. Problematisch wird es, uns zu unterstellen, es sei der Königsweg der Transformation. Das ist nicht unsere Auffassung. Stattdessen legen wir im Buch ausführlich dar, warum der Transformationsprozess eine Einheit aus individueller, kollektiver und gesellschaftlicher Transformation sein müsse. Auch hier hätten wir es interessant gefunden, ein kategorial fundiertes Argument zu lesen, warum das ggf. nicht so sein könne oder warum eine Dimension wichtiger sei als die andere.
Kampf und Opfer
(4) Zander kritisiert, wir würden „implizit unterstellen“, unser „eigener Ansatz erzeuge einen immer breiteren Konsens und stoße auf keinerlei Widerstand“. Denn: „Vorausgesetzt wird dabei eine wahrgenommene Situation, in der man sich von einem ‚Kampf‘ nichts verspricht“. Kampfloses Handeln und Kämpfen wird von Zander in einen Gegensatz gebracht, in dem wir – so verstehen wir die Kritik – die Kampflosigkeit vorziehen würden. Das trifft auch zu. Gleichzeitig sind wir nicht so naiv anzunehmen, dass ein Transformationsprozess ohne handfeste Interessengegensätze ausgetragen werden könnte. Nichtkampf oder Kampf ist aus unser Sicht keine strategische Wahl (wie etwa der Pazifismus), die wir theoretisch begründet empfehlen wollten. Stattdessen ging es uns darum zu verstehen, warum sich Menschen abgestoßen fühlten, „wenn es heiße, ‚Kampf, Kampf, Kampf‘ und eine ‚Opferung der Gegenwart für die Zukunft gefordert‘ werde“. In Zanders Kritik werden wir als Überbringer der Botschaft für den Inhalt verantwortlich gemacht. Tatsächlich setzen wir uns in unserem Buch damit auseinander, warum sich viele Menschen von linker Politik abwenden. Wir diagnostizieren, dass eine Trennung von Weg und Ziel und eine Anforderung der Aufopferung, die Aktivist*innen zur Selbstinstrumentalisierung antreibt, für die mangelnde Attraktivität verantwortlich ist. Ohne dass ein „wofür“ klar ist, wenden sich viele irgendwann erschöpft vom bloßen „dagegen“ ab – so unsere Beobachtung. Was sagt Zander dazu? Nichts. Stattdessen die verallgemeinernde Anrufung: „Menschen nehmen für politische Ziele offensichtlich Opfer und Risiken auf sich, wenn sie sich davon langfristig – eventuell auch über den eigenen Tod hinaus – eine Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen versprechen“. Sicherlich tun sie das, doch wie lange? Und sind es „allgemeine Lebensbedingungen“, für die sie eintreten? Lugt hier die Idee einer Utopie hervor? Es wäre spannend zu lesen, welchen Utopie-Begriff Zander hat. Denn ohne Utopie ist die Bereitschaft im Eintreten für bessere Verhältnisse auch langfristig Risiken in Kauf zu tun nehmen, irgendwann erschöpft. Die historische Intensität und Dauerhaftigkeit der Arbeiter*innenbewegung beruhte nicht zuletzt darauf, dass sie diese Utopie (Erringung der Macht und Gestaltung des Sozialismus) hatte. Es ist jedoch eine Utopie, die sich theoretisch als mangelhaft und praktisch als erschöpft erwiesen hat und erweist. Daher ist es so dringlich an einer neuen kategorialen Fundierung zu arbeiten – ohne in ein begriffsloses Wünsch-dir-was zu fallen. Im Buch haben wir dazu einen Vorschlag vorgelegt. Leider geht Zander darauf nicht ein.
Einheit von Utopie und Transformationskonzept
(5) Zander behauptet, wir würden die praktischen „Widersprüche von ‚Reform‘ und ‚Revolution‘ … in der Theorie zu umgehen versuchen“. Tatsächlich nehmen wir sie sehr ernst und fragen uns, warum sie wieder und wieder reproduziert werden. Wir stellen fest, dass es die politisch-staatliche Form der Transformation, die beiden Ansätzen gleichermaßen zugrunde liegt. Beide Ansätze enthalten gleichzeitig notwendige wie problematische Aspekte. Notwendige Aspekte sind die Momente der Prozesshaftigkeit (Reform) und des qualitativen Bruchs (Revolution); problematisch ist, dass beide den Aufbau einer freien Gesellschaft konzeptuell nicht enthalten, ja, gar nicht denken können. Das sei auch nicht erforderlich, so Zander, denn eine solche läge „erst in einer fernen Zukunft jenseits unser aller Lebensspanne“. Das mag sein, wir wissen es nicht, schon manche Umbrüche kamen auch sehr plötzlich. Zentral für unsere Überlegungen ist jedoch die These, dass es einen inneren Zusammenhang von Weg (Transformation) und Ziel (Utopie) gibt. Politisch-staatliche Transformationen münden notwendig in politisch-staatlichen Organisationsformen einer postkapitalistischen Gesellschaft. Die Erfindung einer Übergangsgesellschaft „Sozialismus“ verschiebt den Widerspruch zwischen staatlich-politischer Herrschaft samt seiner Apparate und einer herrschafts- und staatsfreien Gesellschaft des „Kommunismus“ nicht nur in die Zukunft, sondern sie macht den Übergang in eine freie Gesellschaft unwahrscheinlich. Es kommt eher dazu, dass sozialistische Herrschaftsgesellschaften, die zudem in den Kategorien der Warenproduktion agieren, in die ihnen adäquaten ökonomisch-politischen, nämlich kapitalistischen Formen zurückfallen – was der Zerfall der realsozialistischen Gesellschaften gezeigt hat.
Nun gibt es ein weiteres Argument, dass Zander gegen die inhärente Verknüpfung von Utopie und Transformationskonzept anführt, nämlich, dass die aktuellen Probleme dringlich seien, etwa, „dass der globale Ausstoß von Treibhausgasen schon in zehn Jahren halbiert und bis Mitte des Jahrhunderts auf null reduziert werden muss, wenn die Menschheit überhaupt eine Zukunft haben will“. Wer will das bestreiten. Aber folgt daraus, dass wir weiterhin den historisch gescheiterten Transformationskonzepten folgen müssen? Ist nicht gerade die Dringlichkeit der globalen Probleme Anlass genug, endlich wieder Utopie und Transformation neu zu verknüpfen, um zu verhindern, dass wir den Kapitalismus nur wieder mal bloß erneuern statt ihn endlich aufzuheben? Sollten marxistische Kräfte hier nicht den Anspruch verfolgen, über die gegebenen Verhältnisse hinauszudenken – was unserer Auffassung nach auch die poltisch-staatliche Form einschließt? Um es deutlich hervorzuheben: Dies schließt politische Aktionen, die sich auf staatliche Institutionen richtet, nicht aus, doch sie sollten in ihrer Begrenztheit begriffen und überschritten werden. Der Aufbau neuer Formen der Vergesellschaftung und die Verteidigung im Alten und mit den Mitteln des Alten schließen sich nicht aus, sollten jedoch in ihrer jeweiligen Rolle im Transformationsprozess klar eingeordnet werden. Es ist Zander zuzustimmen, wenn er Altvater (1998, 66) zitiert, wonach „durch soziale Bewegungen dem Kapital Grenzen aufgeherrscht werden (sollten) gegenüber der Grenzenlosigkeit des kapitalistischen Verwertungstriebs“ – doch was ist die positiv-konstitutive Alternative? Was setzen wir einem – hoffentlich begrenzten – Verwertungstrieb entgegen? Wodurch ersetzen wir ihn? In welchen sozialen Formen wollen wir unsere Lebensbedingungen herstellen – wenn nicht in der Warenform und der Verwertungslogik? Alternativen zu diskutieren, die den Kapitalismus überschreiten, sind nicht nur praktisch notwendig, sondern sie können auch wieder zu neuer Motivation im Eintreten für andere, freie gesellschaftliche Verhältnisse führen. Und darin sind wir uns mutmaßlich mit Michael Zander einig.